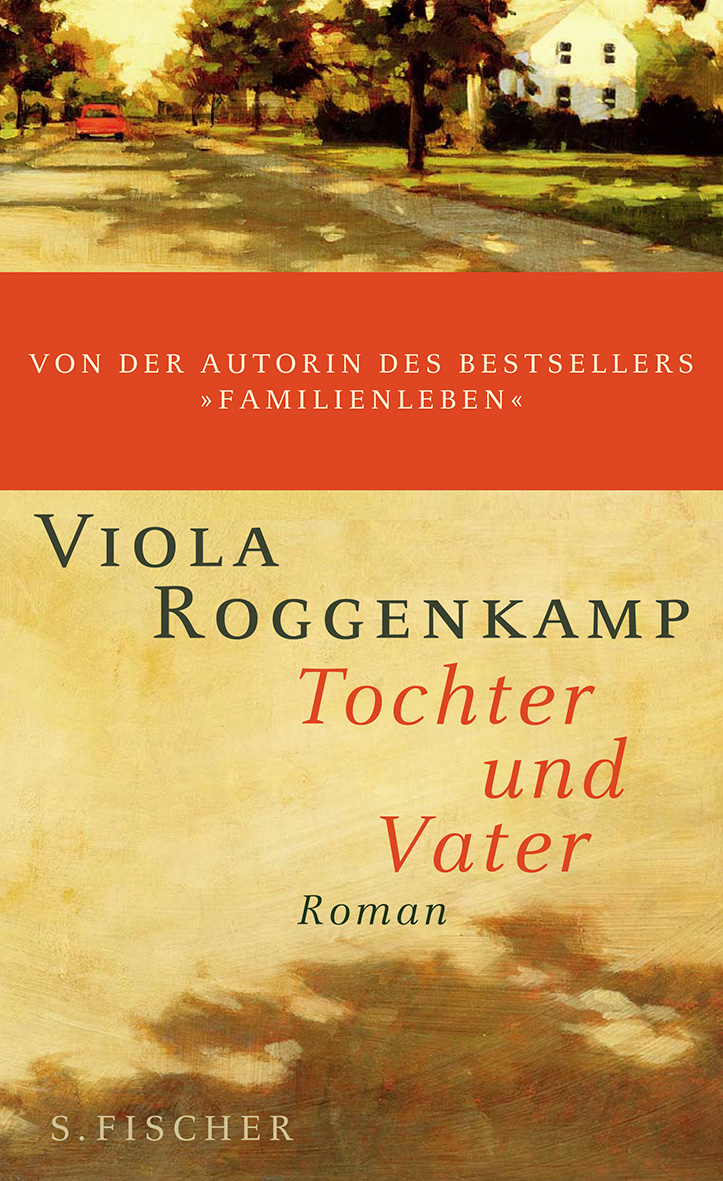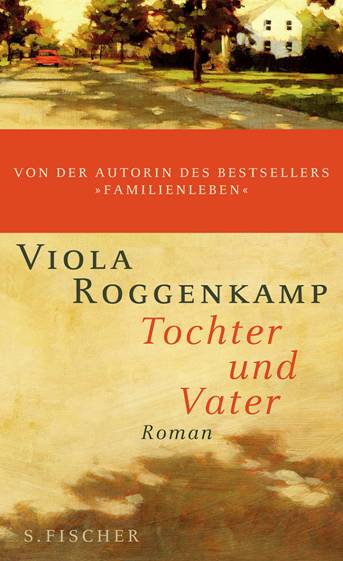Ihr
Vater war kurzsichtig und weitsichtig. Er konnte hellsehen und sah
meistens schwarz.
"Unterhaltungsliteratur
ist das nur im weitesten Sinne, wohl aber ein beunruhigendes, sehr
lesenswertes Buch."
(Ruth
Klüger)
|
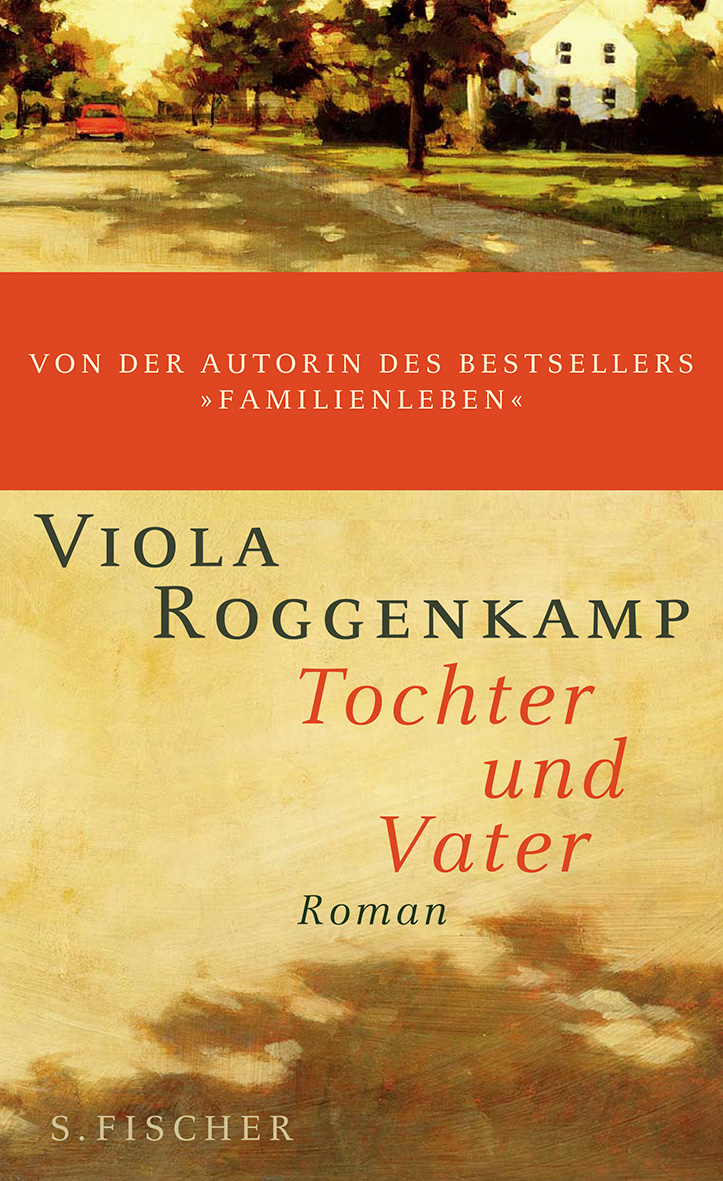
|
Tochter
und Vater
Roman
269
Seiten
S.
Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2011
Nach
ihrem Bestseller »Familienleben« schreibt Viola
Roggenkamp in ihrem Roman »Tochter und Vater« die
Geschichte der deutsch-jüdischen Hamburger Familie fort.
zurück
zur Titelseite
|
Lichtvertiefte
Finsternis
Rezension
von Ruth Klüger – Literarische
Welt
Ein
alter Mann stirbt in Hamburg, seine Tochter will eine Rede bei seinem
Begräbnis halten und bereitet sich einen Roman lang darauf vor.
Bei der Leichenfeier, ein paar Tage später, am Ende des Buchs,
ist sie so besessen von der Furcht, ihr Bügeleisen beim
Verlassen der Wohnung nicht abgestellt zu haben, daß sie
vergißt, die vorbereitete Ansprache zu halten. Dieser Rahmen,
der Tod und Trivia
paart,
ist wie ein schwarzer Witz, der einen tragischen Inhalt umkreist,
nämlich das bedrohte Leben der Eltern der Heldin in der Nazizeit
und die Konsequenzen nach dem Krieg.
Wie
in ihren anderen Büchern beschwört Viola Roggenkamp auch in
„Tochter und Vater“ das oft beschworene Paradoxon einer
deutschjüdischen Symbiose herauf, die nicht stattgefunden und
doch stattgefunden hat, nicht stattfinden wird und doch immer wieder
stattfindet. Roggenkamp hat dieses Verhältnis mehrfach
behandelt, vor allem in ihrem ersten Roman, dem Bestseller
„Familienleben“, der vom Standpunkt eines Kindes eine
deutsch-jüdische Ehe in der deutschen Nachkriegswelt beschrieb,
es dann auch in ihrem Sachbuch über das verdrängte jüdische
Erbe der Familie Thomas Manns kritisch durchleuchtet und wieder
aufgenommen in dem Roman „Die Frau im Turm“, über
die Mätresse Augusts des Starken, die angeblich zum Judentum
konvertierte. In einem Interview zu ihrem ersten Roman sagte die
Autorin: „Jüdisch zu sein und deutsch, das kann es nach
der Schoa eigentlich gar nicht geben. So war nach 1945 bis weit in
die 90er-Jahre hinein das Lebensgefühl in jüdisch-deutschen
Familien. Es dennoch zu sein, jüdisch und auch deutsch, diesen
Zwiespalt, diese Zerrissenheit als ihren eigenen Ort anzuerkennen,
sowohl im Gegenüber zu den Deutschen als auch und gerade im
Gegenüber zu nichtdeutschen Juden: Darum geht es im Leben
jüdisch-deutscher Nachgeborener.“
Der
neue Roman knüpft indirekt an den ersten an. Diesmal ist die
Heldin eine erwachsene Frau, die ihren Wurzeln nachspürt und
gleichzeitig ihr einsames Leben ändern will. Ihre jüdische
Mutter, die den deutschen Vater überlebt und für das
Begräbnis verantwortlich ist, heißt Alma, wie die Mutter
in „Familienleben“, auch der Vater hat seinen Vornamen
Paul aus dem früheren Buch. Doch die Tochter, die Protagonistin,
wird nie beim Namen genannt. Diese Anonymität, scheint mir,
erleichtert das Durchspielen der verschiedenen Zeitebenen; der
ausgesparte Name ist wie eine negative Verdinglichung der
Verstrickungen der Nazizeit mit denen der Gegenwart. Es bleibt etwas
Undurchdringliches, Irritierendes, das uns fehlt, eine Fiktion, die
sich nicht mit der Wirklichkeit deckt.
Die
Tochter fährt von Hamburg nach Krakau, eine Reise, die der Vater
unter den abenteuerlichsten und gefährlichsten Bedingungen
während des Krieges zweimal unternommen hat. Ihr Wissen über
das frühe Liebes- und Eheleben ihrer Eltern war unvollständig,
so oft sie auch darüber gesprochen hatten, denn: „Die
wenigen jüdischen Freunde hasteten durch eigene Grabkammern, und
drängte unter schweren Steinplatten Gewesenes nach oben,
verstummten ihre Eltern.“ Nach Pauls Tod unternimmt es seine
Tochter nun, die Lücken aufzufüllen, indem sie seine alten
Kameraden aufstöbert. Aber die Gegenwart läßt sich
nicht ausschalten, und ihr eigenes Leben geht auf schiefen Bahnen
weiter. Gleich am Anfang der Reise verursacht sie einen
Verkehrsunfall und begeht Fahrerflucht, wofür sie verurteilt
wird, wenn auch nur zu einer Geldstrafe. So wird das Thema Flucht in
den verschiedensten Variationen durchgespielt. Ihr fragmentarisches
Liebesleben steht im Kontrast zum engen, wenn auch verängstigten
Ehebund der Eltern. Und was die Karriere betrifft, so ist die
Vorstrafe eine schlechte Voraussetzung für ein Jurastudium, das
sie abgebrochen hat, aber wieder aufnehmen möchte. Die Gegenwart
läßt sich so wenig ordnen wie die Vergangenheit, vor
allem, weil die letztere auf der ersteren lastet.
In
Krakau war der Vater während des Kriegs von einer Firma
angestellt, die Raubgut für das Reich verwaltete. Unsere
namenlose Protagonistin sucht die Menschen auf, die ihn damals
kannten, Deutsche und Polen, Antisemiten und Widerstandskämpfer,
immer auf der Suche nach Pauls eigentlichem Charakter. War er
schuldig? Er hat drei jüdische Menschen – Frau,
Schwiegermutter, Kleinkind – gerettet, aber was hat er
preisgegeben? Sie fragt sich, „wie oft ihr Vater Heil Hitler
gesagt haben mußte. Diese Peinlichkeit, diesen unanständigen
Ausdruck damaliger Wirklichkeit, hatte sie vor sich verborgen
gehalten.“ Was sie herausfindet, ist allerdings schlimmer als
der verdrängte Hitlergruß. Er, der Nichtjude, hat zwar,
wie sie schon immer wußte, alles für seine Familie aufs
Spiel gesetzt, aber er hat in Krakau Geld verdient im Schleichhandel
mit Raubgut aus jüdischem Besitz. Er war ein Held, und
gleichzeitig war er ein Mitläufer und manches Mal ein Feigling.
Wo sie hingeht, mit wem sie auch spricht, stößt sie auf
unentwirrbare Fäden. Sie sieht sich konfrontiert mit der
Widersprüchlichkeit eines Lebens, in dem ein Mann einerseits dem
Regime zuwider handelte und andererseits mit den herrschenden
Verbrechern mitgelaufen ist und samt seiner Familie von deren
Ausbeutung profitierte. Denn es ging ihnen gut. In nächster Nähe
von Auschwitz ging es ihnen, dank der Enteignung jüdischen
Eigentums, eine Zeit lang aus-gesprochen gut.
Die
Tochter hat am Ende herausgefunden, wonach sie suchte, und beginnt,
sich ihrem eigenen Leben zu widmen. Doch die Schatten bleiben, und
die Autorin erlaubt auch ihren Lesern nicht, einen befriedigenden
Abschluß zu finden. Dank ihrer Kontaktarmut und einseitigen
Besessenheit ist die Protagonistin uns Leserinnen auch nie besonders
sympathisch geworden. Mir fällt ein paradoxes Apercu (von
Goethe? von Kafka?) ein, über eine „lichtvertiefte
Finsternis“. Unterhaltungsliteratur ist das nur im weitesten
Sinne, wohl aber ein beunruhigendes, sehr lesenswertes Buch.
zurück
zur Titelseite
Acht
Jahre lang täglich ein Held
Rezension
von Hans-Jürgen Schings – Frankfurter
Allgemeinen Zeitung
Der
neue Roman von Viola Roggenkamp, erzählt von einer
wohlorganisierten, wenn auch nicht ganz fertig studierten Juristin,
hat die luzide klassische Bauform einer analytischen Geschichte.
Während der Vater an Lungenkrebs stirbt - wo gibt es eine so
unsentimentale und doch zarte Beschreibung eines Sterbenden? -,
übergibt er der Tochter sein Vermächtnis in Form einer
Brieftasche mit Einzelstücken, die sie auf eine Suchreise in die
Erinnerung schicken, bis daraus eine wirkliche Autofahrt in die
Vergangenheit und nach Polen wird.
Da sie eine Totenrede halten will, kommen ihr
neben umfangreichen, aber lückenhaften Aufzeichnungen des Vaters
die Funde aus der Brieftasche nach und nach zu Hilfe. Ein Notizbuch,
eine gefälschte Kennkarte, ein Zettel mit unverständlicher
Aufschrift, eine Złoty-Note,
ein jüdisches Türzeichen, die Mesusa: Alles wird zum
Auslöser von Erkennungen, die, auf dem Höhepunkt der
Erzählung, in schwerer emotionaler Belastung vor sich gehen.
Anagnorisis (Wiedererkennung) nannte schon Aristoteles dieses
Verfahren, lobte es und dachte an den „Ödipus“. Hier
freilich regiert nicht das ödipale Elend, das üblicherweise
mit dieser Form verbunden ist. Wo sich sonst die
Familienunseligkeiten überstürzen, hellen sich hier die
schwierigsten Verhältnisse auf.
Die Eltern - ein wunderbares Paar der
unerschütterlichen Liebe; der Vater - kein Schlappschwanz,
Feigling und müder Versager, wie man meint, sondern in Wahrheit
ein Held, obwohl das Wort nicht paßt, „acht Jahre lang
täglich, alltäglich ein Held“, vielleicht der einzige
Gerechte unter den Deutschen; die Tochter - kein Wunder, daß
sie trotz allen Widerstrebens ein neues Einverständnis mit ihrer
doppelten Identität gewinnt. Der filmreife Detektivroman der
Erinnerung, den Viola Roggenkamp schreibt, ist ein Anti-Ödipus.
Seine Brisanz erhält das kompositorische
Kunststück durch die jüdisch-deutsche
Katastrophengeschichte, der es eingefügt wird. Paul, der Vater,
ist Deutscher, die Mutter Alma und die Großmutter Hedwig sind
Jüdinnen. Ihre Geschichte spielt in den dreißiger und
vierziger Jahren unter den Bedingungen von Krieg und Terror, steht
eigentlich permanent unter Todesgefahr und wird doch begünstigt
von einem schier unfaßbaren Glück, das alle heil
davonkommen läßt. Der seltsame Schmied dieses Glücks
ist der Vater. Verliebt und nichts sonst - „Er las viel, und er
weinte gern beim Lesen“, heißt es über ihn -, wird
er zum Genie der List, die selbst die Nazis in ihrer Berliner
Gestapo-Zentrale außer Gefecht setzt und aus gefälschten
und geraubten Scheinen und Dokumenten, Stempeln und Pässen ein
Netz neuer Identitäten aufbaut, das bis zum Kriegsende hält
und die Jüdinnen rettet. Vor diesem Genie verbeugt sich die
kühle und gründlich mißtrauische Tochter. In der
Erinnerungsarbeit Statur gewinnend, wird sie zur Tochter ihres
Vaters. Obwohl sie sich der Ordnung gemäß als Jüdin
fühlt - „Ist die Mutter Jüdin, sind die Kinder
Juden“. Obwohl sie ihr Jurastudium abgebrochen hat, weil sie
sich nicht vorstellen konnte, „irgend jemanden in Deutschland
zu verteidigen“. Obwohl sie erklärt: „Jüdisch
und deutsch. Eine irrsinnige, eine blödsinnige, eine völlig
meschuggene Mischung.“ 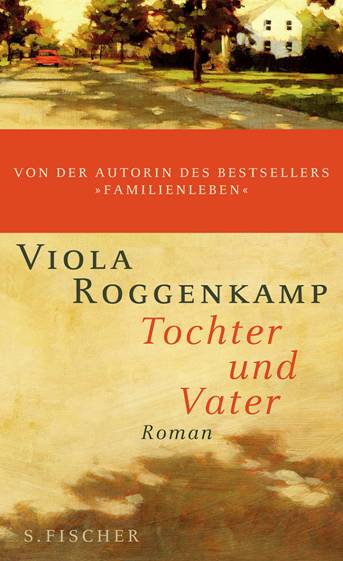
Man erlebt die Rückverwandlung des mäßig
erfolgreichen Vertreters für Brillengestelle, der am
Freitagnachmittag von der Verkaufsfahrt nach Hause kommt, in den
Helden dieser unglaublichen Geschichte. Denunziation und
Strafkompanie, „Rassenschande“ und Konzentrationslager
stehen am Anfang. Die Vernichtung Hamburgs im Sommer 1943 verlagert
sie nach Krakau und beschert ihr, nur wenige Kilometer von Auschwitz
entfernt, eine Zeit des Glücks. „Manchmal war es diesem
Mann und dieser Frau, die später ihre Eltern geworden waren,
gutgegangen, richtig gut, und ausgerechnet in Polen. Wie konnte es
ihnen gutgehen? Um welchen Preis?“ So fragt die Erzählerin,
aus einer Ohnmacht erwachend, in Panik, hat sie doch gerade gehört,
daß ihr Vater „Verbindungsmann zum
Wirtschaftsverwaltungshauptamt Zweigstelle Krakau“ gewesen war,
Verbindungsmann einer Firma, die sich am Besitz der deportierten
Juden bereicherte.
Was sie dann erfährt, im Kreis ehemaliger
polnischer Widerständler, die sich nach über vierzig Jahren
noch gut erinnern, über die unprätentiöse und listige
Menschlichkeit ihres Vaters, den Einbruch im Krakauer Präsidium,
um einen Stempel zu erbeuten, den Schleichhandel im großen
Stil, für den selbst Lastwagen kein Problem sind, die Rückkehr
der Frauen in den Westen, während die Züge mit deportierten
Juden entgegenkommen, wischt alle Schatten und Zweifel weg.
Ihre Mission ist erfüllt. Ohne Auschwitz zu
besuchen, kehrt die Tochter nach Hamburg zurück. Jetzt kann sie
die Totenrede halten und ihren Vater preisen, den einzigen Gerechten
unter den Deutschen. Auch ein Text des Vaters findet da seinen Platz.
„Sie hatte ihn so oft gelesen, sie konnte ihn auswendig.“
Er handelt von den Torturen der Strafkompanie und beginnt mit einem
doch unerlaubten Vergleich, der sie lange beunruhigt hatte: „Es
war in vielen Dingen der Hölle der Konzentrationslager
vergleichbar.“ Jetzt wird dieser Vergleich zugelassen. Acht
Monate Strafkompanie heißt ja auch: Paul wußte, was ihn
erwartete, und er wagte trotzdem alles.
Daß
die Tochter ihre Rede dann doch nicht hält, weil sie während
der Bestattungsfeier an das Bügeleisen denken muß, das sie
womöglich nicht ausgemacht hat, zeigt, wie Viola Roggenkamp das
Pathos, das sich da zusammengeballt hat, unterläuft. Auch sonst
hat sie für allerlei Zutaten gesorgt, die das Erinnerungstableau
nicht übermächtig werden lassen, darunter Unfall,
Fahrerflucht und einen dabei zu Schaden gekommenen Soldaten, der sich
freilich als quicklebendig erweist. Erzählerisch liegt ihr der
Alltag. Zwar kann sie auch ganz anders, es gibt eine geradezu
expressionistische Passage über den Untergang Hamburgs, ferner
Traumsequenz und narratives Eindringen in Bewußtseinsströme.
Durchweg aber herrscht ein behendes Parlando, elliptisch, etwas
atemlos, nicht lange fackelnd. Die Sprache einer
hanseatisch-jüdischen Juristin eben. Daß sie ihre
Totenrede nicht hält, hat auch einen Vorteil: Sie steht statt
dessen als fesselnder Roman auf dem Papier.
zurück
zur Titelseite
Familienerbe
und Tochterliebe
Rezension
Monika Melchert – Sächsische
Zeitung
Nicht
die Geschichte eines Helden, sondern eines Mannes, der Angst hat, der
verzweifelt ist und den seine ausweglos erscheinende Lage zu den
abenteuerlichsten und waghalsigsten Unternehmungen antreibt:
Eindringen ins Reichssicherheitshauptamt der Gestapo in der
berüchtigten Prinz-Albrecht-Straße, Fälschung von
Kennkarten, ohne die man sich nirgends ungestraft aufhalten durfte.
So viele grandiose Episoden, daß der Roman gut für eine
Filmstory wäre. Viola Roggenkamp ist eine feinsinnige, dabei
temperament- und humorvolle Erzählerin, der sich viele
Einzelheiten zur spannenden Szene runden. Das konnte man erst jüngst
wieder in ihrem Roman „Die Frau im Turm“ über das
Schicksal der Gräfin Cosel erfahren. Der Titel des neuen Buches
ist nicht zufällig gewählt: Tochter und Vater. Denn vor
allem will die Tochter über ihr Verhältnis zum Vater
herausfinden. Jetzt, da er tot ist, fühlt sie, ihrem Vater wie
nie zuvor im Leben nahe zu sein. Sie nimmt, als sie das letzte Mal
mit ihm sprechen kann, sein Taschentuch an sich, dieses große,
weiße, sauber zusammengefaltete Männertaschentuch, das ihr
fortan als Beistand dient, wenn sie sich auf die Spurensuche begibt,
tief in seine Vergangenheit hinein. Dem großen Erzählvermögen
von Viola Roggenkamp sind unvergeßliche Episoden über
wundersame menschliche Beziehungen zu verdanken.
Pauls
Coup
Rezension
von Jürgen Verdofsky – Frankfurter
Rundschau
„Und
bitte keine Reden“, wünscht sich der sterbende Paul. „Was
zu sagen wäre, könne sowieso nicht gesagt werden.“
Aber eine Geschichte, die nicht erzählt wird, geht verloren –
am Ende hat sie sich nicht einmal ereignet. Doch ein Geschehen, das
nicht nur vor dem Hintergrund des Schreckens zu begreifen ist,
sondern auch vor dem Wagemut eines Einzelnen innehalten läßt,
verweigert sich jeder Vereinfachung.
Auch ist keine Beschwichtigung zu erwarten, wenn
die Erzählerin Viola Roggenkamp heißt und die feste
Geschichte durch biographische Einschlüsse legitimiert wird. In
ihrem ersten Roman „Familienleben“ erzählt sie vom
Leben einer deutsch- jüdischen Familie nach der Schoa mit dem
Blick einer pubertierenden Nachgeborenen. In ihrem neuen Roman
„Tochter und Vater“, bleibt alles in der Familie. Die
inzwischen gut vierzigjährige Tochter will in ihrer Trauerrede
vor Juden und Nichtjuden auch das Verschwiegene benennen.
1937 wird Paul aus der Strafkompanie entlassen.
Das Militärgericht hatte auf „Verächtlichmachung“
der Wehrmacht befunden. Nach diesem Verdikt steht er völlig
außerhalb der aufstrebenden Nazi-Gesellschaft. Aber daß
er sich bei zwei Jüdinnen, Mutter und Tochter, in Hamburg
einmietet, wird zum lebensbestimmenden Zufall. Paul verliebt sich in
die 17jährige Alma. Das junge Paar wird wegen „Rassenschande“,
wie eines der größten Unworte der
NS-Rechtsverwüstung hieß, in das KZ Fuhlsbüttel
eingeliefert. Nachdem die Gestapo beiden ein Trennungsgelübde
abgepreßt hat, kommen sie noch einmal frei. Aber was ist das
für eine Freiheit.
Alma und ihre Mutter Hedwig Glitzer sind nicht
nur zunehmender Entrechtung, sondern auch mörderischer
Gefährdung ausgesetzt. Paul wird aus Liebe und innerem Anstand
beide retten. Ein sensibler Nichtkonformist, der seinem Umfeld als
lebensuntüchtig gilt. „Paul, der Schlappschwanz“,
nennen ihn seine ahnungslosen Kameraden. Und dieser Mann wird
inmitten der Ausmordung der europäischen Judenheit mit Charakter
und Charisma, Courage und Chuzpe zu einem der wenigen Gerechten unter
den Deutschen. Zwei Jüdinnen zu retten, ihnen zu folgen bis ans
Ende der Welt, das ist ein ganzes Leben über dem Abgrund
moralischer Extreme. Mehr kann ein Einzelner nicht tun.
Für die Tochter heißt das, wie weit
darf sie sich diesem Verhängnis an Prüfungen nähern?
Wo ist das Verschwiegene in der memorierten Rettungslegende. War der
Vater versucht, vor der Größe der Aufgabe zu verzagen? Wie
weit darf man sich mit notgewachsener List und Camouflage in das
Umfeld der Täter begeben? Die Zeit vergeht, die Fragen nicht.
Roggenkamp beschreibt eindringlich Momente der
Bedrohung, trifft Schnappschüsse des Unheils. Paul ist ein
Getriebener, immer auf der Suche nach Schutz für die beiden
Jüdinnen. Er versucht ein camoufliertes Alltagsleben im
besetzten Polen. In Krakau lebt er in ungemütlicher
Nachbarschaft mit den Tätern im Bannkreis der
Konzentrationslager, nach Auschwitz sind es 60 km. Angestellt ist er
bei einer der vielen deutschen Firmen, die den letzten Besitz der
Deportierten verwerten. Paul ist ein Wissender, umgeben von Männern,
die sich an den jüdischen und polnischen Opfern bereichern.
(...) Stempelpapiere aus dem Hauptquartier der Judenmörder, das
bleibt Pauls gewagtester Coup. Aber es kommen noch andere riskante
Aktionen.
In der Nachkriegszeit gelingen den alten
Kameraden, diesen Tätern im Halb-dunkel, neue Karrieren, während
Paul sich als Vertreter für Brillengestelle durchschlägt.
Die Energie des Retters ist verbraucht. Auch an Kraft für
väterliche Hilfe wird es fehlen, seine Zuwendung ist eine
andere. Die Tochter versteht, wie sehr das Leben der Vorangegangenen
zu einem selbst gehört, wenn es so
bedrängt war. Der Abschied vom sterbenden Vater eröffnet
nicht nur den Roman, es ist sein humaner wie literarischer Kern.
Viola
Roggenkamp bewahrt sich bei ihrem Lebensthema den Gestus der
Suchenden, die immer wieder neu ansetzt mit erhellendem Zugriff. Ihre
Technik der metaphorischen Verzweigungen hat sich verfeinert. Sie
erzählt experimentell, setzt Gesetze des Erzählflusses
außer Kraft, die Überblendungen haben Filmtempo. Nicht
alle Szenen erreichen die literarische Höhe des großen
Traummonologs vor den Toren von Auschwitz. Häufiger überprüft
Viola Roggenkamp die Richtung ihres Erzählens, um am Ende, wie
nach einer Selbstüberwindung, jede literarische Zuspitzung
abzubrechen. Die Trauerrede wird nicht gehalten, zum Gedächtnis
wird das Buch.
zurück
zur Titelseite